Gästeseite
Aufklärung als allgemeiner Vernunftgebrauch

«Nicht übers Ganze, aber ein bisschen hatte Kant doch recht», schreibt der ehemalige Autor und Kolumnist der Aargauer Zeitung, Christoph Bopp. In seinem Beitrag begründet und vertieft er seine Erkenntnisse über die Gedankenwelt des Königsbergers, welche auch 2025 ihre akuten Wirkkräfte nicht verloren hat.
«Runde» Jahrestage sind nichts anderes als Anlass zur Erinnerung. Sie sagen nichts aus über die Relevanz des oder der Erinnerten. Immerhin sollten wir 2024 nicht vorbei gehen lassen und die Chance verpassen, uns an zwei Daten zu erinnern, die zufällig gerade «rund» daher kommen: 1784 und 1724. 1784, vor 240 Jahren, erschien in der Berlinischen Monatsschrift Kants Artikel «Was ist Aufklärung?» und 1724, vor 300 Jahren, wurde der Philosoph geboren.
1784 war das, was wir heute «Aufklärung» nennen, schon recht lange im Gange. Etwas vereinfacht kann man sie als Emanzipationsbewegung verstehen, die von einer intellektuell-wissenschaftlichen Elite vor allem gegenüber der Kirche geführt wurde. Natürlich blieb sie politisch nicht folgenlos, das zeigten die Ereignisse ab 1789 in Frankreich deutlich. Kant mahnt 1784 an, dass es keineswegs um eine Elite-Bewegung geht, sondern dass alle zur Teilnahme aufgefordert sind.
«Sapere aude!» - Jeder solle sich selbst seines Verstandes bedienen. Dazu sei nur «Freiheit» nötig. Kant macht dann die einschränkende Unterscheidung zwischen «öffentlichem» und «privatem» Vernunftgebrauch. Der «öffentliche» sollte jederzeit frei sein, während es klar sei, dass, wer «in einem bürgerlichen Posten oder Amte» stehe, sich zurückhalten müsse.
Was Kant nicht schrieb, sondern einfach so unterstellte: Dass wenn jeder selbst denkt, durch reinen Vernunftgebrauch wenn auch nicht gleich das Beste, so doch immer das Bessere herauskomme. Damit traf er auch die Hypothese des Fortschritts, die der Epoche der Aufklärung eingeschrieben war.
Durch das Selbstdenken befreit man sich von Vorurteilen, man befreit sich – das ist vor allem in Religionsdingen offensichtlich – aus «selbstverschuldeter Unmündigkeit». Im Nachgang von Kopernikus, Galilei, Newton und Co. hatte sich vieles, was - vor allem die katholische – Kirche vertrat, als falsch erwiesen.
Mit Hilfe von Bibel und Theologie hatte sie den Menschen etwas vorgegaukelt. Die Aufklärung war demzufolge eine Emanzipationsbewegung aus dem Dunkel ans Licht, in die Realität. In ihrem Buch «Dialektik der Aufklärung» (1944/1947) kritisierten Horkheimer und Adorno den Vernunftbegriff der Aufklärung, der dem Faschismus und den Gräueln des Nationalsozialismus nichts habe entgegen setzen können.
Bereits bei den Griechen habe sich die Vernunft (Logos) über den Mythos gesetzt, gegangen sei es um die Herrschaft über die Natur. Aus dieser ursprünglichen Vernunft-Herrschaft sei dann aber auch die Herrschaft des Menschen über andere Menschen geworden. Im Lauf der Geschichte lasse sich innerhalb der Gesellschaft ein «Verblendungszusammenhang» erkennen, der diese Herrschaftsbeziehung immer wieder und anders verschleiere.
Es lässt sich kaum wegdiskutieren, dass moderne Individuen einen viel tiefergehenden Vernunftgebrauch als Kant und seine Zeitgenossen machen könnten, weil sie über viel mehr Möglichkeiten der Wissensaneignung und Bildung verfügen. Trotzdem wissen sie weniger über die Realität oder scheinen dies wenigstens so zu fühlen.
Heute fürchten sich Menschen vor globalen Risiken und sind auf das Wissen von Experten angewiesen. Heute muss sich keiner mehr winden wie weiland Kant, wenn er sich über Freiheit und Vernunft Gedanken machte. Und trotzdem sind wir Zwängen unterworfen, die weniger vom Staat als von Wirtschaft und Gesellschaft kommen.
Leider hat sich Kants Idee des vernünftigen Individuums nicht durchsetzen können. Das Ideengebäude, das unsere moderne Welt am stärksten bestimmt, die Ökonomie, hat zwar auch einen Begriff von Vernunft. Sie nennt es Rationalität und ist etwas eingeschränkt, weil es sich dabei um eine Eigenschaft oder Fähigkeit handelt, die dem Individuum zukommt.
Kants Vernunftbegriff hat einen universalen Anspruch. Vernünftig ist, was allen - und zwar als Kollektiv – vernünftig vorkommt. Die Vordenker der Ökonomie und vor allem die Erfinder ihrer mehr praktischen Methode, der Spieltheorie, verstehen aber als rationales Verhalten eines, das vor allem individuellen Vorteilen dient. Sie vermeiden «egoistisch», weil wie schon Adam Smith gezeigt habe, dass scheinbar eigennütziges Verhalten gesellschaftliche Vorteile nach sich ziehe.
Folgen dieser eingeschränkten Vernünftigkeit kann man beobachten. Errungenschaften der Vergangenheit, wie zum Beispiel die bürgerliche Freiheit oder der ausgebaute Sozialstaat, die im Kollektiv durchgesetzt wurden und als gemeinsam geteilte Vorrechte betrachtet werden sollten, werden plötzlich als eine Art privaten Besitz betrachtet.
Das Ansinnen, zum eigenen und zum Fremd-Schutz eine Maske zu tragen, wird als Angriff auf die persönliche Freiheit interpretiert und beklagt. Steuern, welche einen gemeinsam geteilten Zustand der Gesellschaft ermöglichen sollen, werden dann gerne als «Raub» betrachtet. Freiheit wird auf ein reines Ich will reduziert. Und beim Vernunftgebrauch bleibt nur das Ich vom Ich denke übrig. Und es wird lautstark gefordert, dass derlei von der Meinungsäusserungsfreiheit geschützt werde.
Was bleibt von der Aufklärung? Im Zeitalter von Deep Fakes muss man niemandem erklären, was ein «Verblendungszusammenhang» ist. Schwieriger ist es, anzugeben, wie man dahinter kommt. Die Vernunft scheint keine konkreten Ziele vorzugeben.
Aber sie ist ein mächtiges Kontrollinstrument, wenn man ihre wichtigsten Bestandteile, universal, kollektiv und solidarisch, im Auge behält. Die Realität mag komplex sein und verwirrend. Aber manchmal gibt es doch eine Art Klarheit – durch Aufklärung.
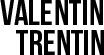


Kommentar verfassen
Kommentare (0)